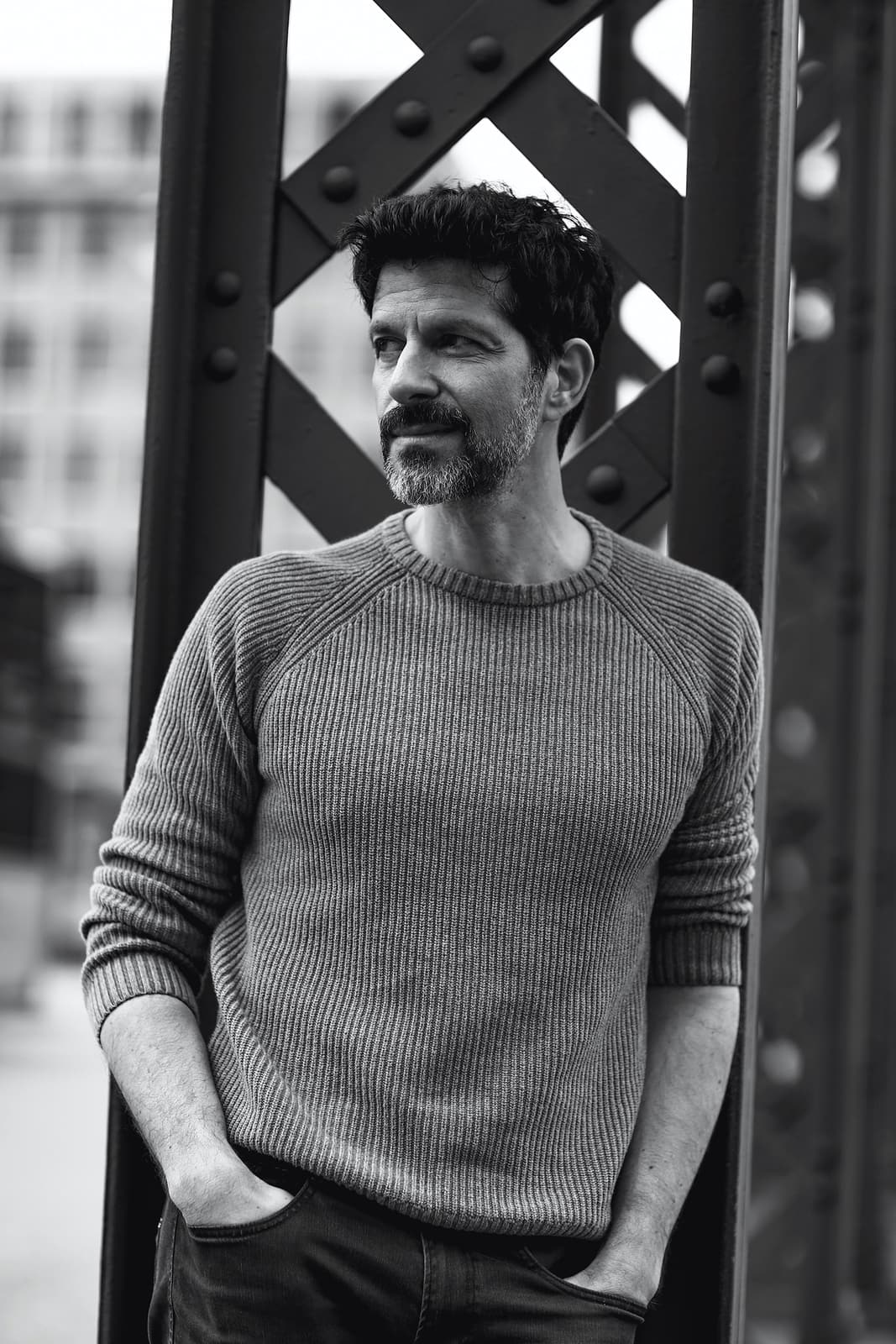Schauspieler Jürgen Vogel über seine Rollen als Kommissar und Familienvater sowie seine Erfahrungen im Berlin jenseits der Spree.
Was reizt Sie an der Kommissar-Figur, die Sie in der TV-Serie «Jenseits der Spree» spielen?
Die Grundidee war, einen Freitagabend-Krimi zu machen, der ein wenig anders erzählt. Robert Heffler ist ein alleinerziehender Vater, der ein guter Polizist zu sein versucht, was ihm aber nicht immer gelingt, da ihn die Konflikte ablenken, die er zu Hause mit seinen drei Töchtern hat.
Ihre vier eigenen und zwei adoptierten Kinder sind zwischen 4 und 35 Jahre alt. Da sind Sie wohl schon als Vater und Grossvater gefordert?
Wenn wir alle zusammen auf dem Spielplatz sind, gibt es manchmal lustige Momente, wenn mich meine Tochter «Papa, kannst du mich mal anschaukeln?» fragt und der Enkel bittet: «Opa, bitte komm zur Rutsche!»
Heffler hat eine heimliche Geliebte, seine Chefin. Haben Sie selbst schon Liebe am Arbeitsplatz erlebt?
Ich habe mich in den letzten vierzig Jahren sicher mal verknallt, aber ich war noch nie mit einer Schauspielerin längere Zeit zusammen. Bis ich meine jetzige Verlobte kennenlernte, hätte ich es mir gar nicht vorstellen können, weil man in diesem Beruf so viel unterwegs ist, dass ein Paar sich kaum noch sieht, wenn beide erfolgreich sind.
Wie haben sich Natalia Belitski und Sie kennengelernt?
Ich verkörperte 2016 im Zweiteiler «Familie!» einen Koch, der verheiratet ist und ein kleines Kind hat, und Natalia spielte meine Assistentin. Sie arbeiteten aber nicht nur zusammen, sondern hatten auch ein Verhältnis.
Werden Sie und Ihre Verlobte bald wieder einmal gemeinsam vor der Kamera sehen?
Ich würde sehr, sehr gerne mit ihr drehen. Möglicherweise werde ich dabei Regie führen. Ich bin jetzt 55 und möchte mich in nächster Zeit auch auf diese Weise einbringen. Eine Produktionsgesellschaft für Independent-Filme habe ich bereits 1996 mit Matthias Glasner gegründet.

Sie spielen auch in Werbefilmen. Der Sparkasse-Werbespot 2006 sah aus, als hätten Sie mal ausprobieren wollen, wie es sich anfühlt, James Bond zu spielen …
(Lacht) Es macht mir einfach Spass, in interessanten, lustigen Filmen Werbebotschaften auf originelle Art zu vermitteln. Wobei das Geld nicht allentscheidend ist. Ich muss schon hinter dem stehen können, was ich mache und was das für ein Unternehmen ist.
Sie lieben es, als Schauspieler aus Ihrer Komfortzone herauszugehen. Wo tun Sie es im richtigen Leben?
Als Vater oder im Kampfsport, den ich betreibe, wo du nichts bist als derjenige, der du bist, und deinen inneren Schweinehund jedes Mal neu überwinden musst. Richtig bequem mache ich es mir also auch privat nicht und bei der Arbeit ist das genauso. Aybi Era, welche Mavi spielt, mit der Robert ein Team bildet, und ich schreiben uns nach den Drehtagen abends oft noch Textnachrichten mit Änderungsvorschlägen und Dialogideen.
1986 sind Sie nach Berlin gezogen, weil man dort keinen Wehrdienst leisten musste. Was schreckte Sie daran am meisten ab?
Ich hatte in der Schauspielerei gerade Fuss gefasst und fürchtete, dass ich in Vergessenheit geraten könnte, wenn ich anderthalb Jahre zum Bund müsste. Ausserdem habe ich ein kleines Autoritätsproblem. Wenn man mir dort etwas befohlen hätte, dass ich gar nicht hätte nachvollziehen können, wäre ich vielleicht in den Bau gewandert.
Wie kam es, dass Sie in Berlin zwei Jahre in einer WG mit dem heutigen «Tatort»-Kommissar Richy Müller lebten?
Ich hatte ihn kurz zuvor bei einem Dreh kennengelernt. Obwohl er 13 Jahre ->
-> älter ist, verstanden uns auf Anhieb super. Er war auch ein grosses Vorbild. Sozialdramen wie «Die grosse Flatter», wo er die Hauptrolle spielte, hatten mich sehr beeindruckt.
Robert De Niro in «Taxi Driver» soll auch eine wichtige Inspiration gewesen sein. Mit ihm haben Sie aber keine WG gebildet oder?
Ne, leider nicht! (Lacht) Ich durfte ihm aber mal kurz die Hand schütteln, als er mir 2006 in New York an seinem Tribeca Film Festival den Schauspieler-Preis für «Der freie Wille» überreichte.

Köpenick liegt jenseits des schicken und weltstädtischen Berlins. Was macht diesen Kiez für «Jenseits der Spree» spannend?
Es ist eine Art von Stadtteil, die Berlin auch ausmachen, mit einer guten Mischung aus ganz normaler Arbeiterklasse und jungen Kreativen, welche die Lebensqualität schätzen und die bezahlbareren Mieten. Und er hat Motive, die noch nicht so oft zu sehen waren.
Bekannter wurde Köpenick in jüngster Zeit auch durch die Erfolge des FC Union. Sind Sie ein «Unioner»?
Sagen wir’s so: Ich finde den Verein wahnsinnig toll, echt sympathisch! Unser Regisseur, der ein Fan ist, hat uns auch mal zu einem der Club-Abende mitgenommen, an dem wir mit den Unionern einen Schnack über ihren Fussball und unsere Serie hatten.
Urs Fischer, der zum Trainer des Jahres gewählt wurde, stammt aus Zürich. Haben Sie einen Bezug zur Schweiz?
Ich habe schon verschiedentlich in der Schweiz gedreht, «Wachtmeister Zumbühl» mit Urs Odermatt und «Zornige Küsse» mit Judith Kennel. Rudolf Santschi ist ein ausgezeichneter Produzent. Das liegt aber schon länger zurück. Es wäre also an der Zeit, dass sich wieder etwas ergäbe. Vielleicht kann ich Einfluss darauf nehmen, wenn ich als Regisseur arbeite.
Der Schauspieler Jürgen Vogel wurde am 29. April 1968 in Hamburg geboren. Er schaffte den Durchbruch mit Sönke Wortmanns Komödie «Kleine Haie» (1992). Weitere Meilensteine sind «Das Leben ist eine Baustelle» (Deutscher Filmpreis 1997), «Der freie Wille» (Silberner Bär 2006), «Die Welle» (2008) und die Thrillerserie «Blochin» (2015). Vogel lebt mit seiner Verlobten Natalia Belitski und ihrer Tochter in Berlin-Charlottenburg. Er ist aktuell dienstags um 20.05 Uhr auf SRF 1 und freitags um 20.15 Uhr im ZDF in der 3. Staffel der Krimiserie «Jenseits der Spree» zu sehen.
Photos Copyrights: Stefan Klüter, ZDF/Oliver Feist